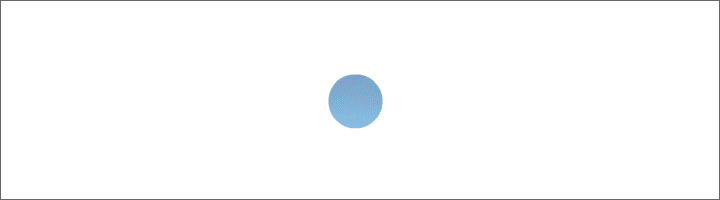NaRrENTAgE
Der Narr lebt ohne Sorgen
Nicht im Gestern oder Morgen.
Sein Paradies ist jetzt und hier.
Drum sei er ein Vorbild mir!
Seine Heimat ist kein Ort
schläft heute hier und morgen dort.
Lebt froh in den Tag hinein,
trifft heute jeden oder kei`n
Wo ankommt er, bedeutet ihm nicht viel,
dem Narren ist der Weg das Ziel.
Menschen lieben den Wirbelwind,
weil er so ist, wie sie nicht sind.
Lebt unbeschwert im Nirgendwo.
Sein Narrenleben mach ihn froh.
Trägt stolz sein buntes Narrenkleid.
Sein ist das Leben und die Zeit.
Weil im Jetzt er lebt.
Und das Glas erhebt.
auf die Liebe, die Fahrt und den Mut.
Loslassend Eitelkeit, Dünkel und Wut.
Aus gestern wird Heute. Aus Heute wird Morgen.
Nun läuft er davon, um ein Verslein zu borgen.
Ein leeres Blatt Papier. Ein neuer Tag. Eine großartige Idee. Eine erste Begegnung. Sie alle haben eines gemeinsam: Magie. Die Magie jenes Momentes, in dem noch alles möglich ist. Das leere Blatt wartet darauf beschrieben, der neue Tag gelebt, die großartige Idee umgesetzt und die erste Begegnung gestaltet zu werden. Magie pur, die einen Sog entwickelt, dem ich mich noch nie entziehen konnte: Begeisterung. Also möchte ich damit beginnen: mit Magie, Begeisterung und einem ersten Schritt.
Der erste Gedanke: ich muss mal raus. Raus aus dem täglichen Einerlei, raus aus allem, was einengt oder Angst macht. Raus, fort - irgendwohin, wo es schön ist. Und schon steckte ich mittendrin in der Magie der unendlichen Möglichkeiten. Noch könnte ich auf die unterschiedlichste Art reisen, jeden Ort der Welt aufsuchen, in jede Richtung gehen, trampen, fahren, wie es mir in den Sinn kommen würde.
Der zweite Gedanke: Was will ich tun? Ich kenne Leute, die den erstbesten Zug nehmen der losfährt, irgendwo unterwegs aussteigen, um sich von diesem zufällig gewählten Ort überraschen zu lassen. Eine originelle Idee, die mir jedoch eher für einen Tagesausflug geeignet erscheint. Auch trampen ist spannend. Als ich jünger war, bin ich gern per Anhalter gefahren und habe Begegnungen und Gespräche mit den Fahrern genossen, die mich eine kurze Strecke mitgenommen haben. Doch im Grunde musste ich es nicht so kompliziert machen, denn hier kam die Begeisterung ins Spiel. In den letzten fünfzehn Jahren, habe ich einen Großteil Europas mit dem Rad bereist. Das war abenteuerlich und wunderschön. Deshalb beschloss ich, eine Radtour unternehmen.
Der dritte Gedanke: wohin soll ich fahren? In der Bibliothek suchte ich mir Reiseliteratur heraus. Besonders Flussradwege führen mich in Versuchung. Elbe, Havel, Oder und Neiße kannte ich schon. Doch Mosel, Donau, Altmühltal oder Rhein wären mit Sicherheit ebenso faszinierend. Tour Brandenburg - ein dünnes Heftchen weckte mein Interesse. Auf unserer letzten Tour begegneten mein Freund und ich einem Mann, der diesen Rundweg fuhr und begeistert davon war. Ich sah mir die Karte an und entdecke, dass ein Einstieg nach fünfzig Kilometern in Herzberg erreicht wäre, und die Städte Brandenburg, Rathenow und Havelberg Teile der Tour sein würden. Dies erleichterte es mir einen Entschluss zu fassen, denn in dieser Region fand in jenem Jahr die Bundesgartenschau statt. Und weil ich schon immer den Wunsch verspürte eine solche zu besuchen, beschloss ich, einen Teil der Tour Brandenburg auf meinem Drahtesel zu fahren.
Nachdem ich mich entschieden hatte, freute ich mich auf die Fahrt. Sechs Tage lang würde ich mich morgens irgendwann auf den Weg machen und abends irgendwo anzukommen. Narrentage, ausgefüllt mit Begegnungen und Plaudereien in unendlich langen lauen Sommernächten, in denen Zeit sich ins unendliche dehnt und allein nach schönen Momenten gemessen werden würde.
1. Tag
Huckleberry Finn ist schuld, an meiner Reisemacke. Oder eher Mark Twain, der Erfinder des Jungen? Doch ohne meine Omi, die mir das Buch von den Erlebnissen des cleveren Burschen geschenkt hat, hätte ich beide nicht kennengelernt. Also war sie es, die den Grundstein für meine Reisemacke gelegt hat. Huckleberry Finn machte gewaltigen Eindruck auf mich. O.K. mir hat auch Tom Sawyer gefallen, aber der war eher wie ich: wenn der was erleben wollte musste er sich seine Erlebnisse organisieren. Doch Huck Finn, der zwar ein Dieb war und log dass sich die Balken bogen, war auch gutmütig, hilfsbereit und vor allem Eines: neugierig. Eine Eigenschaft, die ich mit ihm gemeinsam habe: der kleinste gemeinsame Nenner sozusagen. Was nicht heißen soll, dass ich nie lüge. Ich könnte Ihnen Dinge erzählen …, aber lassen wir das, sonst verliere ich meinen Faden vollkommen. Huck hat sich auf ein Floß gesetzt und ist damit den Mississippi runter gefahren und obwohl er es nicht wollte, haben ihm Neugier und Hilfsbereitschaft die haarsträubendsten Abenteuer beschert. Nun ja, ich bin wenigstens in einer Sache mit ihm auf einer Wellenlänge, dass ich meine Übernachtungen nicht vorher plante und dort nächtigen würde, wo ich einen Platz dafür fände. Jemand könnte einwenden, dass ich in Deutschland unterwegs war und so ein Unterfangen nicht schwierig ist, aber ich bin eine Frau mit Sicherheitsbedürfnis und deshalb erforderte allein, mich auf diese Ungewissheit einzulassen, ungeheuren Mut.
Ist es vorstellbar? Ich war fast Einhundert Kilometer durch urige Landschaften und gemütliche kleine Orte geradelt. Eine Kirchturmuhr schlug 17:00 Uhr und es wurde langsam Zeit mich zu informieren, wo ich übernachten konnte. Ich begann mich nach Hinweisen umzusehen. Auf einer Tafel, die nach etwa einhundert Metern am Wegesrand stand, befand sich allerdings nur eine Landkarte und einige Inserate, die auf Pensionen und Gasthöfe hinwiesen. Doch als ich über den Rand der Tafel schaute, erblickte ich in zirka 30 Metern Entfernung auf einem Schild das Zeltplatzsymbol. „Was will ich mehr?“ dachte ich, als ich in die angezeigte Richtung radelte und glücklich war über diesen unglaublichen Zufall. Wozu eine kleine Änderung des Blickwinkels doch gut sein konnte!
Den Namen des Ortes, den ich nach zwei Kilometern erreichte, hatte ich bereits vergessen, als ich am Ortseingangsschild vorüber gefahren war. Es war nicht mehr als eine Häuserzeile im Nirgendwo. Der Zeltplatz, der sich auf dem Privatgelände eines Bauern befand, war gut ausgestattet. Hecken trennten einzelne Bereiche voneinander, so dass der Eindruck von Beschaulichkeit entstand. Sanitär- und Aufenthaltsräume befanden sich in einer Scheune. Während ich meinen Polyesterbungalow aufstellte, kam der Bauer zu mir, um zu kassieren. Ich fragte ihn, ob er Bier verkaufen würde und er brachte mir zwei Flaschen. Eine trank ich gleich als Zielbier und währenddessen unterhielten wir uns. Anschließend zog ich los, um zu duschen und danach aß ich mein Abendbrot in der Scheune, in der ein kleiner Teil für einen großen runden Tisch und die dazugehörigen Stühle abgegrenzt war.
Noch war der Himmel blau und der Tag, der unglaublich heiß und sonnig gewesen war, träumte der nahenden Dämmerung entgegen. Ich schlenderte los, um mir das Dorf anzusehen. Die Abendsonne ließ die Schatten wachsen und zauberte Goldhauch auf die Umgebung. Ich schlenderte die Dorfstraße bis zu ihrem Ende und wieder zurück, beguckte kleine aus roten oder gelben Ziegeln gebaute Häuschen, die meist ein- selten zweigeschossig waren. Die ersten Sterne begannen am am tiefblauen Himmel zu blinkern. Blaue Stunde nennen dies die Fotografen, eine Tageszeit, die sich besonders gut für Nachtfotos eignet.
Wieder zurück auf dem Zeltplatz, faltete ich aus meinen Sachen ein Kopfkissen, kroch in meinen Schlafsack und träumte einem neuen, abenteuerlichen Tag entgegen.
2. Tag
Ich bin in der DDR in dem Bewusstsein aufgewachsen, dass jedem Menschen ein Leben in Glück, Wohlstand und Frieden zusteht. Dass solch ein Leben mein gottverdammtes Recht ist. Tja, das war ja dann wohl nichts. Ich habe mich nur immer wieder gefragt, warum so viele Menschen trotz der geplanten Glückseligkeit unglücklich waren. Richtig! Weil Glück sich nicht verordnen lässt und auch nicht jeder Mensch auf die gleiche Art glücklich wird. Menschen sind Individuen und daher trotz vieler Gemeinsamkeiten unterschiedlich. Der eine malocht bis zum Umfallen, der nächste braucht seinen Garten, ein Anderer seine Ruhe und ich brauche mein Fahrrad, eine schöne Gegend und Sonnenschein zum Glücklichsein.
Am Morgen frühstückte ich, ging anschließend Zähne putzen, baute das Zelt ab, belud mein Tretross und schon war ich unterwegs. Die Sonne meinte es gut und heizte dem Tag ordentlich ein, ein laues Windchen wiegte reifes Getreide und Sonnenblumen auf Feldern, die bis zum Horizont reichten. Der Asphalt surrte unter meinen Reifen, dass es eine Lust war. Wege schlängelten sich über hügeliges Gelände, über dem die Luft flirrte.
Die Idylle trog allerdings, denn was man weder sah noch roch, waren das Gyphosat und andere Pflanzengifte auf den Feldern, die dafür verantwortlich sind, dass Insekten in den letzten dreißig Jahren bis auf 30 % dezimiert wurden. Als ich dies las, war mein erster Gedanke: „Wer braucht schon Insekten?“ und dachte dabei an Mücken, Fliegen und andere lästige Quälgeister.
Doch nicht nur unsere Vogelwelt leidet unter fehlendem Nahrungsangebot. Nein, auch für uns Menschen werden sterbende Insekten zur Gefahr, denn wer soll Blüten von Obstbäumen und Getreide bestäuben, wenn die Mägen der Bienen der ausgebrachten Pflanzengifte wegen explodieren? Pestizide sind auch für unsere Mägen und Därme nicht gut, wie die vielen Menschen mit Nahrungsmittelallergien beweisen. O.K. Wir leben im Kapitalismus und da ist Gewinnmaximierung auf Kosten der Gesundheit nichts neues. Für die Bauern ist Glyphosat natürlich ein Segen, weil es ihnen mehrere Arbeitsgänge erspart, wenn sie es vor der Saat auf die Felder sprühen und damit ihre Gewinne erhöhen. Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass die Menschheit keinen dritten Weltkrieg braucht, um sich auszurotten und der einzige tröstliche Gedanke ist, dass auch die Menschen, die heute Entscheidungen mit Dollarzeichen in den Augen treffen, sich in Zukunft den Konsequenzen ihrer Handlungen nicht entziehen können.
Inzwischen haben fortschrittlich denkende Menschen Organisationen gegründet, die sich dafür einsetzten, dass dieser Irrsinn gestoppt wird. Und weil alles immer nur schlimmer wird, wenn sich niemand engagiert, hatte ich beschlossen, zu tun was mir möglich erschien: Seit Kurzem engagiere ich mich bei Unterschriftenaktionen der Organisationen „Campakt“ und „Mehr Demokratie“, um Politiker nicht mit jeder Fehlentscheidung durchkommen zu lassen.
Hatte ich schon erwähnt, dass ich außer einem Ringbüchlein der Tour Brandenburg, keinerlei Kartenmaterial dabei hatte? Nein, dann tue ich das jetzt. Der Weg war gut ausgeschildert und so hatte ich das Büchlein, das sich meiner Meinung nach eher zur Planung eignete, in meinem Gepäck verstaut, an das ich während der Fahrt nicht herankam, ohne zuerst Zelt, Schlafsack und Pennmatte abladen zu müssen. Dies rächte sich an diesem Tag, denn erst in Jüterbog stieß ich wieder auf meine Route und stellte fest, dass ich am Kloster Zinna vorbeigefahren war. Mir blieb nur die Wahl, entweder weiter zu fahren, oder einen Umweg in Kauf zu nehmen, wenn ich es ansehen wollte. Meine Neugier siegte. Ich entschied, die kurze Strecke dorthin zurückzufahren, was sich als glücklicher Umstand erwies, denn nachdem ich mir die Klosteranlage und den dazugehörigen Park angesehen hatte, machte ich es mir im Biergarten eines Restaurants gemütlich und aß gleich zu Mittag.
In Treuenbriezen aß ich einen Eisbecher. Zwei Kugeln Schokoladeneis mit Schlagsahne, mmh, war das lecker! Der Mensch gönnt sich ja sonst nichts! Anschließend verfuhr ich mich, weil ich die Karte nicht richtig las. Eine Familie auf Sonntagsausflug gabelte mich auf und geleitete mich lachend und schwatzend auf den rechten Weg. Das er es nicht war, merkte ich zu spät, als ich kilometerweit an der Hauptstraße entlang fuhr. Es war staubig, laut und öde, weshalb ich bei passender Gelegenheit in die Richtung abbog, in die ich ursprünglich hatte fahren wollen. Der Ortsname Klein Marzehns sagte mir etwas und letztendlich hatte ich wieder Glück: das Hinweisschild auf einen Zeltplatz, welches ich auf halber Strecke entdeckte, war nicht zu übersehen. Noch ein paar Kilometer und ich war am Ziel. Der Kilometerzähler zeigte auch an diesem Tag wieder über neunzig gefahrene Kilometer an.
Auf einer Bank saß bereits ein Radfahrer, der eine Pulle Bier vor sich auf dem Tisch stehen hatte. Weil am tiefblauen Himmel nicht das kleinste Wolkenfetzchen zu sehen war gesellte ich mich zu ihm. Ausnahmsweise ignorierte ich die ungeschriebene Globetrotterregel, nach der am Ende der Tour zuerst das Zelt aufgebaut werden muss, damit alle Sachen trocken untergebracht sind, falls es zu regnen beginnt. Beim Platzwart bestellte ich zwei Flaschen Hopfenblütentee, als ich mich anmeldete. Der Herr am Tisch und ich kamen ins Gespräch. Mit dem Austausch von Namen gaben wir uns nicht ab, am nächsten Morgen würden wir in verschiedene Richtungen weiter fahren und uns im Leben nie wiedersehen.
Jedoch habe ich mir angewöhnt, den Menschen, die ich unterwegs treffe Namen zu geben. Hinter der Anonymität versteckt, lässt es sich zwar gut quatschen, meine Geschichten wirken jedoch interessanter und lebendiger, wenn die Leute Namen haben. Außerdem ist ein Name wichtig, denn ohne einen solchen ist der Mensch neben mir ein Niemand. In dem Moment, in dem ich ihm einen Namen gebe ist er nicht mehr Irgendwer. Er wird wichtig. Deshalb dachte ich mir einen Namen aus für ihn. Der Herr am Tisch schien etwa so alt zu sein, wie meine Wenigkeit und daher überlegte ich, wie die Jungen in meiner Schulklasse hießen: Thomas nervte, Olaf war unordentlich, Mike Choleriker, Jörg ein Streber. In Steffen war ich verliebt, René hatte Pickel, Michael einen Hund und Erik zehn Brüder. Heiko und Erik hatten Vornamen als Nachnamen. Außerdem war Erik ein guter Kumpel. Also: Kumpel Erik, das passte prima.
Erik war ein wandelnder Reiseführer. Er erzählte mir von Radtouren, die er mit seiner Tochter unternahm und ich beneidete ihn darum, denn für mein Kind existierte ich seit Jahren nicht mehr. Wir unterhielten uns über Touren, die wir bis dahin unternommen hatten und über solche, die für die Zukunft geplant wurden. Außerdem verriet er mir, wie man sich unterwegs schmutzige Hände waschen kann, indem man einen Schluck Wasser aus der Flasche in den Mund nimmt und dieses anschließend über die schmutzigen Finger rinnen lässt. Er berichtete, wie er im Wald auf überdachten Rastplätzen biwakiert, indem er die Schlafmatte auf den Tisch legt und sich darauf im Schlafsack einkuschelt. Ich gestand ihm, das dies keine Option für mich wäre, weil ich nach einer Tour gern dusche und mich aus Angst in die Hosen pieseln würde, sollte ich gezwungen sein, allein im Wald zu übernachten. Jeder knarzende Ast, jedes raschelnde Blatt, Schniefen oder Eulenhuhu würde mir eine Heidenangst einjagen. Die Zeit verging wie im Fluge. Ich verkrümelte mich, als die Bierflasche leer war, um mein Zelt aufzubauen. Als der Stoffpavillon schließlich stand, nahm ich Brot, Wurst, Käse und meine zweite Flasche Bier mit zum Tisch. Zu Erik hatte sich inzwischen Olaf gesellt, der sein Zelt erst gar nicht aufgebaut, sondern Pennmatte und Schlafsack auf der Terrasse eines der Bungalows ausgebreitet hatte. Jeder legte auf den Tisch, was er an Nahrungsmitteln mitgebracht hatte und wir speisten zusammen und plauderten über Gott und die Welt bis am Himmel Millionen Sterne funkelten und es mir zu kalt wurde. Ich wünschte meinen Gesprächspartnern eine gute Nacht, stapfte hügelan zu meinem Zelt und kuschelte mich darin in meinen Schlafsack.
3. Tag
Ich erwachte, als die Morgennebelschwaden noch rosa gefärbt über den Wiesen hingen. Erst als ich mit dem Frühstück fertig war, schob die Sonne ihr Wolkenbett beiseite und es wurde schnell warm. Ich hatte bereits gefrühstückt und fertig gepackt, als Erik und Olaf aus den Federn gekrochen kamen und sich streckten und gähnten. Sie begutachteten mein Gepäck, gaben sachkundige Kommentare dazu ab und ich verabschiedete mich nach einem kurzen Plausch von ihnen.
Weitläufige Felder, wechselten mit nach Harz duftenden Wäldern, die Sonne glühte über der Landschaft, sonst passierte auf meiner Tour nicht viel. Außer, dass ich gut voran kam natürlich.
Dreißig Kilometer vor Brandenburg legte ich in Lehnin eine Rast ein und besichtigte das gleichnamige Kloster: Rote Backsteinbauten mit Kirche und Kreuzgang, um einen kleinen Park gruppiert. In der Kirche probten Sänger für eine Aufführung von Mozarts Zauberflöte in den nächsten Tagen. Die Akustik war phantastisch und ich setzte mich und lausche der wunderschönen Musik. Die Koloraturen der Rachearie der Königin der Nacht schwebten in dem Raum wie ein Teppich aus Klängen. „Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen...“ oh, je wie dramatisch! Für mich symbolisiert diese hinreißende Melodie jedoch viel eher den Schmerz einer Mutter, deren Tochter entführt wurde. Mozart beabsichtigte mit der Figur des Priesters Sarastro in der Zauberflöte einen fortschrittlichen Herrscher darzustellen. Dies ist ihm meiner Meinung jedoch nicht gelungen, weil ich von dieser Robin-Hood-Mentalität überhaupt nichts halte. Wieso wird jede Ungerechtigkeit, jede Grausamkeit und jedes Verbrechen plötzlich zu einer Heldentat, weil sie begangen werden im Namen von Gott, Vaterland, Gerechtigkeit und Ehre, oder was die Menschheit sonst noch an dramatischem Humbug zur Rechtfertigung erfinden mag? Und was bitte schön, ist daran fortschrittlich? Seitdem Menschen in kleinen Gruppen um ein Lagerfeuer saßen und in der Lage waren das Wort Krieg auszusprechen, mussten dafür immer an den Haaren herbeigezogene Begründungen herhalten und es ist höchst bedauerlich, dass sich daran bis heute nichts geändert hat. Doch nur, weil ich solche Gedankengänge nicht nachvollziehen kann, müssen sie nicht schlecht sein. Irgendeine Logik wird schon dahinter stecken. Oder?
Da ich die Welt ohnehin nicht retten kann, schob ich diese Überlegungen beiseite, als ich an einer Eisdiele vorüber kam. Ich kaufte mir ein leckeres Schokoladeneis und während ich dieses genoss suchte ich nach einem Hinweis in welcher Richtung ich die Stadt verlassen konnte.
Es war früher Nachmittag, als ich vor Brandenburg an einem geschlossenen Bahnübergang warten musste. Neben mir stand eine Radfahrerin, die im Gegensatz zu mir eingemummelt war, wie im tiefsten Winter. Lange Hosen, langärmeliges Trikot, das Gesicht durch Mund- und Kopftuch geschützt. Du lieber Himmel! Hatte ich irgendetwas verpasst? Einen Atomschlag? Oder hatte es wieder einmal einen Supergau in einem Atomkraftwerk gegeben? Die Möglichkeit bestand natürlich, immerhin hatte ich alles zu Hause gelassen, was es mir ermöglicht hätte die neuesten Nachrichten mitzubekommen. Mein Handy lag, wie immer eigentlich, vergessen auf dem Wohnzimmertisch. Ohne die üblichen Schreckensszenarien in den Medien hatte ich in meinem selbst erschaffenen Kokon aus sonnigem Wetter, üppiger Landschaft und inspirierenden Begegnungen, herrlich wie in einer rosaroten Blase, paradiesische Tage verlebt. Und ganz ehrlich? Wer will schon wissen, wenn die Menschheit die nächste Katastrophe zu entfesseln geruht? Also ich bestimmt nicht. Wozu denn? Verhindern kann ich sie sowieso nicht und wenn der Weltuntergang unmittelbar bevorsteht, ist immer noch der günstigste Zeitpunkt, um davon Kenntnis zu nehmen und zu tun, was man kann, um heil da raus zu kommen.
Das die Person neben mir Asiatin war, bekam ich erst mit, als ich sie fragte, ob sie mir vielleicht sagen könnte, ob und wo es in Brandenburg eine Möglichkeit gab, das Zelt aufzubauen. Da zog sie ihr Mundtuch herunter, schob Kopftuch und Sonnenbrille auf die Stirn und sah mich so verwundert an, dass ich gleich wusste, dass die junge Frau kein Wort verstanden hatte. Doch mit meinen verschwindend geringen Schulenglischkenntnissen, Mimik und Gestik verständigen wir uns schließlich. Sie zeigte mir einen Stadtplan auf ihrem Handy, auf dem ich ein Zeltplatzsymbol im Randgebiet Brandenburgs erkennen konnte. Eine Weile fuhren wir noch zusammen, als der Zug vorbeigerauscht war und sich die Schranken gehoben hatten, doch wenig später bog sie zum Bahnhof ab, um dort ihre Freundin abzuholen.
Ich bin nicht besonders gut im Kartenlesen, doch die ungefähre Richtung hatte ich mir gemerkt, genauso wie den Umstand, dass ich nicht über die Havel fahren durfte. Also hielt ich an der Brücke die über den Fluss führte und frage ein paar alte Damen, die an einer Ecke standen und schnatterten, ob sie vielleicht wussten, wie ich zum Zeltplatz kam. Sie beschrieben mir den Weg so ausführlich, dass ich den Campingplatz nicht verfehlen konnte.
Dort angekommen, meldete ich mich im Restaurant bei einer Kellnerin an, die mir einen Plan in die Hand drückte, auf dem die, für die Zelte vorgesehenen Plätze eingezeichnet waren. Dieser war jedoch vollkommen veraltet, denn auf dem größten Teil der für die Camper ausgewiesenen Flächen standen Caravans und Wohnwagen. Viel Auswahl gab es daher nicht, um den Stoffpavillon aufzubauen. Hinter dem Restaurant befand sich direkt am Ufer der Havel eine schmale Wiese. Brr, meine Wirbelsäule schmerzte allein bei dem Anblick der vielen Unebenheiten. Ansonsten hatte ich die Wahl zwischen einem ebenen Quadratmeter am Rande der „Camperwiese“ und einer großen kahlen Fläche in der Mitte der selben, für die ich mich entschied.
Gerade war ich dabei mein Gestänge zusammenzubauen, als mir jemand auf die Schultern klopfte und mich fragte, ob ich mein Zelt nicht lieber woanders aufbauen wollte. Verwundert sah ich mich um. Hinter mir stand ein alter Herr, der auf meine unausgesprochene Frage antwortete, dass auf diesem Fleck gut zwei Zelte stehen könnten. Verlegenheit trieb mir Röte ins Gesicht. Auf diesen Gedanken hätte ich ruhig selbst kommen können! Rücksichtslosigkeit gehört nicht zu meinen Eigenschaften und meine Gedankenlosigkeit war mir peinlich.
Als ich auf den kahlen Quadratmeter umzog, der mir vorhin schon aufgefallen war, brachte ich den Mittsechziger nun meinerseits in Verlegenheit, denn er wollte mir mehrere andere Plätze schmackhaft machen, auch den auf der Buckelwiese. Doch ich lehnte sämtliche angebotenen Alternativen ab und blieb bei meiner Wahl. Um zu zeigen, dass ich ihm seine Einmischung nicht übel nahm lud ich ihn ein, mit mir an einem der Tische platz zu nehmen, die auf der Terrasse der Gaststätte standen. Der Herr, der schlank, braun gebrannt und nur mit einer Badehose bekleidet war, sah, mit dem bunten Tuch, welches er sich um den Kopf geschlungen hatte, wie ein Pirat aus. Während auf meinem Kocher Teewasser heiß wurde plauderten wir.
Meine neue Bekanntschaft verriet mir, dass er Rolf hieß und als Hochspannungselektriker tätig war, bevor er in Rente ging. Meinerseits berichtete ich, dass ich gerne koche und mein Hobby zum Beruf gemacht hatte und von meiner Ausbildung zur Rechtsanwaltsfachangestellten, als sich herausstellte, dass ich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in einer Küche arbeiten durfte. Wir plauderten über Gott und die Welt, kamen vom Hundertsten ins Tausendste und waren am Ende unseres Gespräches bestens über gesunde Ernährung, die jeweiligen Freizeitaktivitäten und Nachbarschaftsstreitigkeiten des anderen informiert. Schließlich verabschiedete Rolf sich mit dem Hinweis, dass er sich auf die Suche nach dem Dorf machen wolle, in dem seine Oma früher wohnte und ich wünschte ihm viel Glück.
Danach spule ich das Nachmittagsprozedere ab: Zelt fertig aufbauen, Straßenstaub wegduschen, auskundschaften, wie ich morgen zur Gartenschau kommen würde. Zufrieden stellte ich fest, dass die Anlegestelle des Wassertaxis Einhundert Meter vom Campingplatz entfernt war.
„Und, hast du den Ort gefunden, in dem deine Großmutter gelebt hat?“ fragte ich den alten Herrn als erstes, als er am späten Abend zurück kam und sich wieder an meinen Tisch setzte. Obwohl er meine Frage bejahte, schien er deprimiert.
„Stimmt es,“ löcherte ich ihn, „dass du das Gefühl, nach Hause zu kommen, nicht gefunden hast?“ Ich erzählte ihm, dass ich vor einigen Jahren in den Harzort Gernrode gefahren war, in dem meine Omi lebte und wo ich sie als kleines Mädchen in den Ferien besuchen durfte. Irgendetwas hatte gefehlt, und erst viel später war mir bewusst geworden, dass ich dieses wunderbar heimelige Gefühl vermisste, dass sich einstellte, als meine Oma mit mir an der Hand durch den Harz gewandert war und Geschichten „von früher“ erzählt hatte. Und obwohl ich vieles wiedererkannte und das Haus in dem ich sie besuchte, ganz toll saniert worden war, vermisste ich doch die Stimmung des Heimkommens und Vertrauten.
„Weißt du was?“, sagte Rolf daraufhin nachdenklich: „Selbst wenn Deine Oma noch lebte, würdest Du dieses Gefühl nicht mehr empfinden, weil sich nicht nur der Ort, sondern auch Du dich verändert hast. Und auch Deine Großmutter wäre nicht mehr die selbe Person, die du als Kind gekannt hast.“
Verblüfft nicke ich. Seine Erklärung machte mich zwar traurig, aber andererseits wurde mir klar, wie recht er mit seinen Gedanken hatte. Mir wurde wieder einmal bewusst, warum ich es liebe unterwegs zu sein: wegen der unverhofften Begegnungen mit Menschen, wie Rolf, die mir ihre Weisheiten mit auf den Weg geben.
Als wir zusammen Abendbrot aßen, kam die Asiatin, die ich am Bahnübergang getroffen hatte, mit ihrer Freundin angefahren und ich war froh, dass ich den Platz in der Mitte der Campingwiese frei gelassen hatte, denn die Zelte der beiden jungen Frauen passten perfekt dahin. Rolf sprach ein wenig besser Englisch, als ich und so erfuhren wir, dass die beiden Mädels aus Thailand kamen und eine kleine Reise durch Deutschland unternahmen, bevor sie beginnen würden zu studieren. Die, die ich schon kannte, wollte in Leipzig Betriebswirtschaft studieren, während die andere sich für ein Medizinstudium entschieden hatte. Während Rolf und ich zuschauten, wie die Freundinnen ihre Zelte aufbauten, erklärte er mir, dass die beiden jungen Frauen deshalb so bedeckt fahren würden, weil sie verhindern wollten braun zu werden. In ihrem Heimatland sind Menschen mit heller Haut angesehen, je dunkler die Haut eines Menschen jedoch ist, umso mehr wird er ausgegrenzt.
Oh Gott dachte ich, hat die Menschheit keine anderen Probleme? Doch andererseits empfand ich ein fast befriedigendes Gefühl der Schadenfreude bei dem Gedanken, dass Rassismus und die daraus folgende Diskriminierung überall auf der Welt und nicht nur in Deutschland ein Problem ist.
4. Tag
Ich wollte sehr zeitig aufzustehen, um etwas vom Tag zu haben. Einen Wecker hatte ich nicht nicht mitgenommen. Diesen brauchte ich aber auch nicht, weil mein Rücken, beziehungsweise die Schmerzen, die dieser nach einer Nacht auf der Isomatte verursacht, der beste Wecker ist, den man sich vorstellen kann. Doch an diesem Morgen benötigte ich auch diesen „Wecker“ nicht, denn die Sonne brannte zeitig vom Himmel und es wurde so heiß im Zelt, dass es darin nicht mehr auszuhalten war. Nachdem mich Klärchen aus dem Schlafsack geworfen hatte, frühstückte ich zusammen mit Rolf und als dieser sich nicht überreden ließ, die Gartenschau anzusehen, verabschiedeten wir uns von einander. Ich lief zur Wassertaxianlegestelle und er brauste mit seinem Caravan davon.
Die Gartenschau war wunderschön und fantasievoll gestaltet und ich hatte viel Freude beim Besichtigen der vielen bunten Blüten und liebevoll arrangierten Ausstellungen.
Halb vier war ich pflasterlahm zurück auf dem Zeltplatz und beschloss spontan, gleich nach Rathenow zu fahren. Ich gebe zu dass ich geschummelt hatte, was die Suche nach einem Zeltplatz betraf. In dem Heftchen der Tour Brandenburg gab es Hinweise auf Übernachtungsmöglichkeiten und so hatte ich die Sicherheit, dass es am Ende meines Weges eine Möglichkeit geben würde, mein Zelt aufzubauen.
Die Handgriffe mit denen ich meinen Polyesterbungalo abbaute, waren mir bereits in Fleisch und Blut übergegangen und gingen mir daher flott von der Hand. So dauerte es nicht lange bis ich mich auf den Weg machen konnte.
Trotz der glühenden Hitze genoss ich die Fahrt. Schließlich kühlte der Fahrtwind und die Landschaft gefiel mir. Mit Besorgnis beobachtete ich allerdings die Wolken am Himmel, die sich in einem riesigen Areal zu gewaltigen Gewittertürmen, wie eine riesige Krone um mich herum aufzutürmen begannen.
Mein Wasser reichte gerade bis zum Ortseingangsschild Rathenows und ich war froh, als ich auf der Fahrt durch den Ort eine Frau in einem Vorgarten beim wässern ihrer Rosenbeete entdeckte. Gleich bremste ich und bat sie, mir etwas Wasser in meine Flaschen nachzufüllen und sie tat mir den Gefallen gern.
Karin sah mich an und danach mein Fahrrad und befand, dass es zum Radfahren viel zu heiß sei, was ich heroisch bestritt. Ich zählte die Vorteile auf, die so ein Urlaub für mich hat und sie schwärmte von ihrem Urlaub in den Dolomiten, den sie mit ihrer Familie dort verbracht hatte. Schließlich fragte ich Karin nach dem Zeltplatz und hatte Glück, dass ich in ihr jemanden gefunden hatte, der informiert war. Sie riet mir, den gekennzeichneten Weg zu verlassen, am Ort vorbei und nach einem Kilometer über eine Brücke zu fahren bis zu einem Kreisverkehr. Zum Abschied bedankte ich mich nochmals für das Wasser, das sie mir spendiert hatte.
Ich fand alles, wie von ihr beschrieben, auch den Hinweis auf den Campingplatz im nächsten Ort. Dort angekommen, stand ich vor einer schwierigen Entscheidung. Die Gewitterbedrohung war sehr real geworden. Heftige Sturmböen trieben trockenes Laub vom Vorjahr über den Boden, düstere Wolken fegten über den Himmel, es donnerte ohrenbetäubend und wetterleuchtete, als wollten die himmlischen Scharen ihre gesamte Pyrotechnik testen. Deshalb wollte ich den Polyesterbungalow so schnell wie möglich aufbauen. Jedoch erfuhr ich in der Rezeption, dass die Gaststätte zwanzig Uhr schloss und ich nichts mehr zu essen bekommen würde, wenn ich mich jetzt für den Aufbau meiner Stoffbehausung entschied. Na toll. Viel Zeit hatte ich nicht, eine Entscheidung zu treffen und so stellte ich kurz entschlossen mein Rad unter das Vordach, dass es nicht nass werden konnte. Erste schwere Regentropfen pladderten auf den Boden und vertrieben mich vom Freisitz. Na gut, nun war die scheinbare Katastrophe da und ich nahm in der Gaststube platz. Nach einem Blick in die Karte bestellte ich mir ein großes Bier und ein Schnitzel mit Pommes und Champignons. Ich ließ mir den Appetit von der bedrohlichen Situation nicht verderben und aß mit Genuss. Was passieren würde, konnte ich nicht aufhalten und entschlossen hatte ich mich nun einmal. Doch ein Blick aus dem Fenster verriet mir, dass ich bisher Glück hatte! Es war zwar noch immer bedrohlich düster und die Wolken rasten wie eine wilde Bisonherde über die Welt, aber das beginnende Gewitter war bisher nur eine leere Drohung gewesen.
Als ich mein Bier getrunken, dass Essen verputzt und bezahlt hatte regnete es immer noch nicht. Juhuuuuu! Erfreut darüber, schob ich mein Rad zur empfohlenen Wiese und unterhielt mich, während ich Zelt, Isomatte und Gepäck von meinem Tretross lud mit einem Ehepaar, das auf dem von einer Hecke abgegrenzten Nachbargrundstück campierte und mit seinen beiden Söhnen unterwegs war.
Besorgt blickte ich zum Himmel. Wenn sich die Wolken jetzt entschieden ihren Inhalt herunterzuschütten, wäre ich bestimmt innerhalb von Minuten nass bis auf die Haut. Brrrrr, nasse Klamotten, waren schon immer das Einzige, was mir eine Tour so richtig vermiesen konnte. Doch ich verzichtete darauf die Regenklamotten aus dem Gepäck zu wühlen, denn nun schien es auf jede Minute anzukommen. Immerhin, blieb es weiterhin trocken. Das Gewitter drohte zwar mit Blitz und Donner, aber es war unklar, wie lange es noch so blieb.
Der Aufbau meiner Stoffbehausung stellte sich als Geduldsprobe heraus, weil der Untergrund unter dem Rasen so steinig war, dass es mir nur mit List und Tücke gelang die notwendigsten Heringe in den Boden zu hämmern. So etwas hatte ich noch nicht erlebt! Die Zeltnägel verbogen sich und ich bekam sie nur in den Boden, wenn ich zwei zusammen in eine Schlaufe steckte und dann sehr vorsichtig zuschlug. Gott sei dank hatte ich den Hammer nicht als unliebsamen Ballast zu Hause gelassen! Ohne ihn wäre ich vollkommen aufgeschmissen gewesen.
Nachdem mein Gepäck im Zelt verstaut war, suchte ich mein Waschzeug heraus und lief zu den Duschen. Zu meiner Freude blieb es auch jetzt trocken und war es auch dann noch, als ich frisch gewaschen und die Zähne geputzt nach einer Dreiviertelstunde in warmen Sachen aus den Waschräumen kam. Prima! Nun hatte ich sogar noch Zeit, zum kleinen See zu laufen und mich ein wenig umzuschauen. Es war stockdunkel und ich musste aufpassen, wo ich entlang lief. Am Ufer stehend, schaute ich den letzten orangenen Fetzchen, die vom Sonnenuntergang noch übrig waren, dabei zu, wie sie davonsegelten.
Einige junge Männer kamen die Böschung herunter gelaufen. Sie beguckten sich meine Klamotten und begannen sich für die Art, wie ich meinen Urlaub verbrachte zu interessieren. Natürlich gab ich der Versuchung nach, ein wenig anzugeben: mit meinen Träumen von großen Fahrten, die ich mir schon erfüllt, den Ländern die ich bereist hatte und von den Abenteuern der Tour, die ich gerade fuhr. Schließlich beschwerten sie sich, dass in der Gegend hier nichts los sei, doch ich hielt dagegen, dass überall so viel los war, wie sie los machten. Sie waren skeptisch, weil ich die Auffassung vertrat, dass jeder für das, was in seinem Leben passierte, oder eben nicht, selbst verantwortlich ist.
Einer von ihnen erwähnte den Riesenjackpot, den es in der Lotterie in dieser Woche zu geben schien und ich lachte herzlich, als ich hörte wie die jungen Leute schwärmen, was sie mit der sprichwörtlichen Million beginnen würden. Natürlich wollten sie sich große Autos, Villen, Markensachen und Weltreisen leisten. Arbeiten gehen? Wie bitte? Natürlich nicht! Ich kenne solche Diskussionen von meinen Arbeitskolleginnen. Die wollten sich vom Partner trennen, um- oder ausziehen, ausschlafen und sich schöne Reisen und schicke Klamotten gönnen. Die Frage kam natürlich: „Was würdest du tun?“ Und meine Antwort war: „Nichts. Ich muss mein Leben nicht ändern, weil ich das auch ohne Lottomillionen hinbekommen habe.“ Ich hatte mir einen neuen Partner gesucht, der besser zu mir passte, als der alte und die Weltreise unternahm ich häppchenweise, jedes Jahr in ein anderes Land. Die jungen Männer zweifelten, ob das so einfach möglich sei, da gäbe es doch immer diesen oder jenen Grund, warum es gerade jetzt nicht möglich war... und nachdem sie ihre Zigaretten zu Ende geraucht hatten, wünschten wir uns eine gute Nacht. Sie taten mir leid, weil sie den Schlüssel zum Glück so leichtfertig verwarfen, denn sie knüpften daran Bedingungen: Ja wenn....dann....wäre alles ganz einfach, anders, besser. Narr! dachte ich mit einem Blick auf das dunkel schimmernde Wasser vor mir. Ich war der Narr, der nur im heute lebt, der die Vergangenheit begraben und seine Zukunft „entsorgt“ hatte, weil man nur im heute, hier und jetzt etwas tun und ändern kann. Und der Narr in mir freute sich, weil genau das der Grund ist, weshalb ich das schöne Gefühl habe, dass mein Leben und meine Zeit mir gehören.
Als ich mich in meinen Schlafsack gekuschelt und mein Zelt verschlossen hatte, begann es zu nieseln. Tropf, tropf, pitsch, platsch klang es leise, doch bald ging dieses Klopfen in ein stetiges Rauschen über, dass sich als Einschlafmusik bestens eignete.
5. Tag
Der Morgen war kühl und trübe und die Luft roch wie frisch gewaschen, nachdem der Regen den Staub in der Nacht heraus gespült hatte. Während ich an einem überdachten Tisch saß und frühstückte, kämpfte sich die Sonne durch die Wolkendecke und als ich aufbrach war es heiß, wie in den vergangenen Tagen und am blauen Himmel kein Wölkchen mehr zu sehen.
Die Gartenschau in Rathenow war herrlich phantasievoll angelegt. In einem riesigen Gelände gab es eine Überraschung nach der anderen zu bewundern. Rondelle auf denen Blumen jeweils nur in roten, blauen oder gelben Farbtönen angepflanzt waren. Ein See in dem es Seerosen in vielen Formen und Farben zu bewundern gab und einen Steg auf dem man gehen und die ganze Pracht aus der Nähe ansehen konnte. Ich staunte, wie viele Ideen hier umgesetzt worden waren. Das ganze Gelände kam mir vor, wie eine Feier, bei der Farben, Formen und Düften gehuldigt wurde: Dahlien und Rosen in allen erdenklichen Farben, Rhododendronhain, Bäume in denen Baumgeister wohnten, eine moderne schwungvolle Brücke über die Havel, die zwei Ausstellungen miteinander verband, es war eine Freude hier auf Entdeckungsreise zu gehen. Ich hatte gelesen, dass es einen transportablen Aussichtsturm gab, den BUGA-Skyliner, der eine Zeit lang in jeder der Städte stand, die zur Gartenschau gehörten. Zum Glück für mich stand er gerade in Rathenow. Eine ringsum verglaste rotierende Kabine brachte mich und etwa sechzig weitere Besucher nach oben. Aus Achtzig Metern Höhe genoss ich einen grandiosen Blick auf die Havelauen. Es war ein wunderbarer Vormittag voller wunderbarer Erlebnisse und Überraschungen.
Danach fuhr ich zum Riesensupermarkt, kaufte mir ein Stück Melone und und eine Pappe Ananassaft, mit dem ich meine Trinkflaschen auffüllte. Die Melone war wunderbar süß, saftig und aromatisch und nachdem sie in meinem Magen verschwunden war, ritt ich die vierzig Kilometer bis Havelberg auf der linken Arschbacke herunter. Ich hatte etwas Leckeres gegessen, radelte durch eine eindrucksvolle Landschaft und der Tag strahlte förmlich vom Sonnenschein. Was braucht der Mensch mehr zum Glücklichsein? Oh, ja ich war sehr sehr glücklich.
Havelberg kannte ich bereits, weil ich vor einigen Jahren mit meinem Freund auf unserer Elbradwegtour hier Rast gemacht hatte. Deshalb wusste ich, wo ich ohne langes Suchen ein Restaurant an der Havel fand, wo ich leckeren Kartoffelsalat mit Bulette essen konnte und mit der Suche nach dem Zeltplatz hatte ich auch kein Problem. Allerdings merkte ich, dass ich spät dran war, denn die besten Plätze waren schon belegt und ich musste mich mit dem zufriedengeben, was übrig war. Ich überlegte lange, bevor ich mich für das geringste Übel entschied. Für zwei Nächte allerdings konnte ich mich auch mit einem Platz zufriedengeben, der mir nicht gefiel, nur feuchter dunkler Boden, ohne einen Grashalm zur Dämpfung. Nach dem Aufbau des Zeltes und einem Bad in der lauwarmen und von Algen grün gefärbten Havel, setzte ich mich auf die Terrasse der Zeltplatzgaststätte und bestellte ein Bier. Nach der Fahrt in der Sonne und mit dem beruhigenden Bewusstsein, die Sachen sicher im Zelt verstaut zu haben, hatte ich mir den Zieltrunk verdient.
Eine Gruppe Camper, die am Nebentisch Platz genommen hatten, bezog mich in ihr Gespräch ein und bald saßen wir in einer fröhlichen Runde zusammen. Schnell Bekanntschaften zu schließen und offen für Gespräche mit anderen zu sein war für mich nicht immer selbstverständlich, was daran lag, dass ich einmal sehr schüchtern war. Es war meine Freundin Brigitte, die mich ermutigte, zu vertrauen, aus mir herauszugehen und meine Meinung zu vertreten.
Alles hatte damit begonnen, dass meine Chefin mich zu einer Zusatzausbildung schicken wollte, bei der ich zum Gaststättenleiter weitergebildet werden sollte. Ich wollte erst gar nicht hin. Wozu? Ich hatte das Schulbankdrücken und vor allem die dazugehörenden politischen Belehrungen satt. Und ganz ehrlich? Zum Leiter tauge ich, wie ein Dieb, der den Goldschatz bewachen soll. Meine Oma beendete meine diesbezügliche Diskussion jedoch mit dem Hinweis, dass mir im Leben alles materielle genommen werden kann, aber niemals Wissen, das ich irgendwann erworben habe. Dieses Argument klang für mich vernünftig, weshalb ich doch hin ging. Zunächst hielt ich mich zurück, beobachtete erst einmal und hörte zu. Dabei fiel mir Brigitte zum ersten Mal auf. Sie war direkt, hatte Humor und etwas zu sagen und tat dies auch laut und deutlich. Schlicht: sie hatte das Herz auf dem rechten Fleck und ich bekam schnell mit, dass es nur zwei Möglichkeiten gab: Entweder man mochte sie oder man lehnte sie ab. Ein Zwischending gab es nicht. Ich war von ihr begeistert, weil sie das genaue Gegenteil von mir war: forsch, fröhlich und mit einer tiefen saftigen Lache. Wir wurden gute Freundinnen. Sie lud mich ein und ich war bald ein häufiger Gast in ihrer Kantine, die sie an den Lübschützer Teichen gepachtet hatte, ein Gebiet in der Nähe Wurzens, mit Zeltplatz und Laubenkolonie.
Das Allerschönste waren jedoch die Abende in ihrem Garten. Die Kantine musste Dreiundzwanzig Uhr geschlossen werden und wer von den Stammgästen danach noch keine Lust hatte schlafen zu gehen, den lud sie ein, in ihrem Garten weiter zu feiern. Alle legten zusammen, damit genug zu trinken da war. Einige trugen Bierkästen, andere Schnapsflaschen und dann saßen wir alle um ihren großen Gartentisch.
Während der Mond seine Bahn zog, das Bier schmeckte und die Schnapsgläser immer wieder gefüllt und gelehrt wurden, plauderten wir über Dieses und Jenes und kamen vom Hundertsten ins Tausendste. Selbst wenn über Politik diskutiert wurde, was zu DDR-Zeiten heikel war, gab es nie Streit. Es ging hoch her, was normal war, wenn jeder der Anwesenden seine Meinung vertrat und auch zu bestimmten Problemen von jedem eigene Lösungsansätze diskutiert wurden. Oh, wie ich diese Runden liebte! Oft lehnte ich mich einfach nur zurück und lauschte, wie Gespräche und Gelächter in die Nacht hallten und genoss das Gefühl dazuzugehören. Es waren immer sehr interessante Leute dabei. Dünkel gab es zumindest dort nicht, in Brigittes Runde diskutierten Ingenieur, Arzt, Schlosser, Kneiperin, Köchin und wer sonst anwesend war, miteinander und alle waren gut gelaunt und jeder brachte sich in die Gespräche ein.
Wenn ich heute Politiker dabei beobachte, wie diese Lösungen für aktuelle Konflikte suchen, dann denke ich hin und wieder an den runden Tisch in Brigittes Garten. Viel anders als dort in der kleinen Runde, kann es in der großen Politik auch nicht zugehen. Viele unterschiedliche Parteien, genau so viele verschiedene Meinungen und alle müssen unter einen Hut bekommen werden, um Lösungsansätze für Konflikte zu finden. Nur das die Probleme ein Land oder mehrere betreffen und die „Stammtischgäste“ besser gekleidet und prominenter sind.
6. Tag
Himmel war die Welt schön! Ein strahlender Sommertag war am Morgen über den Horizont geklettert und Havelberg war eine Augenweide! Die Stadt hatte sich schick gemacht. Das Rot der Dächer, das Bunt der Fassaden und alles Grüne drum herum schimmerte vom Goldhauch der Sommersonne überglänzt so intensiv, wie man es nur von Postkarten kennt. Und über allem blaute der Sommerhimmel. Ich fühlte mich frei und aller Sorgen ledig und alles war prächtig: die Stadt, der Dom, die Ausstellungen und der Fluss, in dem sich diese wundervolle Welt spiegelte.
In der Stadtkirche wurde an diesem Vormittag eine Orchideenschau neu gestaltet und es machte Freude, den vielen fleißigen jungen Frauen zuzusehen, die die Blumen vorsichtig aus den gelieferten Kartons nahmen, diese sorgfältig schnitten, banden, steckten. Jeder Handgriff schien zu sitzen und das Ergebnis war großartig.
Durch die Straßen schlenderte ich zum Dom, besah Bauerngärten, Duftpelagonien in Hochbeeten und genoss Aussichten über Stadt und Havelauen. Nachdem ich mir im Bereich „Grabgestaltung“ einige einzigartig kreativ und liebevoll gestaltete Gräber angesehen hatte wanderte ich zum „Haus der Flüsse“. Auf dem Weg dorthin, inmitten der Besuchermassen trottend, wäre ich an der Hauptattraktion (für mich war sie das auf jeden Fall!) fast vorbeigelaufen. Vor mir breitete sich eine bunte Sommerwiese aus. Auch wenn die Sonne noch so heiß vom Himmel knallte, musste ich erst einmal innehalten. Was für eine Augenweide! Und niemand blieb stehen, um diesen Anblick zu feiern. Das war kein Rasen, knalliggrün und zurechtgestutzt, wie ein Igelhaarschnitt. Grün ja, aber dazwischen hineingesprenkelt eine Million Blüten in hunderttausend Farben. Wahnsinn! Ich fand`s toll, dass das Einfachste gleichzeitig das Allerschönste war. Bedauerlich nur, dass ich auf meinen Radtouren so etwas noch nie in „freier Wildbahn“ gesehen habe.
Nachdem ich mich im „Flüssehaus“ über die Region Mittelelbe informiert hatte, knurrte mein Magen und ich bestellte, als ich in die Stadt zurückgekehrt war, in einem chinesischen Restaurant eine Portion gebratene Ente mit Gemüsereis. Als mein Teller leer war, war es Fünfzehnuhrdreißig und ich überlegte, womit ich den angebrochenen Tag noch füllen könnte. Ja klar! Auf unserer Elbradtour hatten mein Freund und ich die Kirche in Werben nicht besichtigt, wozu jetzt Gelegenheit war. Also zog ich mich um, trieb mein Pedalross an, setzte mit der Fähre über die Elbe und kam trotzdem zu spät. Es war halb sechs, als ich in Werben eintrudelte und die Kirche hatte seit Anderthalb Stunden geschlossen.
Statt St. Johannis anzusehen, unterhielt ich mich mit der Gemüsehändlerin auf dem Marktplatz, mit der mein Freund und ich bereits im Jahr zuvor geschnattert hatten. Diese Frau ist ein Original, freundlich, fröhlich, mitteilsam und mir deshalb sehr sympathisch. Sie ist Mitglied im Altstadtverein, an ihr ist eine gute Stadtführerin verloren gegangen und alles, was sie über die Geschichte der Stadt nicht weiß, ist höchstwahrscheinlich uninteressant. Ich mag Menschen, wie sie, die sich für eine Sache begeistern und diese Begeisterung an ihre Mitmenschen weitergeben, so wie sie es in diesem Moment mit mir tat. Als wir uns trennten, hatte ich zwar die St. Johanniskirche nicht besichtigt, doch dafür unglaublich interessante Informationen erhalten, Sympathie getankt und einen Spätnachmittag voller Freude verbracht.
Erst als ich zum Abendbrot ein Schnitzel mit Champignons verdrückte und einen gekühlten Hopfenblütentee dazu trank kam mir der Gedanke, dass, wenn man den Medien glaubt, die Menschheit insgesamt schlecht, grausam und unvernünftig ist. Schlage eine Zeitung auf, sieh einen Film oder eine Doku, unterhalte Dich mit Deinem Nachbarn, es kommt immer auf eines hinaus: die Menschheit zettelt Kriege an, verballert Ressourcen, vermüllt und vergiftet die Erde und nirgendwo ist eine Ende dieses Wahnsinns abzusehen. Und dann gehst Du auf Reisen. Und auf dieser Reise begegnen Dir die Menschen, die das Herz auf dem rechten Fleck haben, die Humorvollen, die Informierten, die Offenen, die Begeisterten und Unvoreingenommenen. Die, die ihre Weisheiten mit Dir teilen, die mit Dir lachen und Dich verstehen. Deshalb bin ich gern unterwegs.
statt des siebenten Tages:
Gruß der Morgendämmerung:
Sieh diesen Tag!
Denn er ist das Leben, ja das Leben selbst.
In seinem kurzen Lauf
Liegt alle Wahrheit , alles Wesen deines Seins.
Die Seligkeit zu wachsen,
Die Freude zu handeln,
Die Pracht der Schönheit.
Doch gestern ist nur ein Traum.
Und morgen ist nur ein Bild der Phantasie.
Doch heute, richtig gelebt, verwandelt jedes Gestern
In einen glückseligen Traum
Und jedes Morgen in ein Bild der Hoffnung.
So sieh denn diesen Tag genau!
Das ist der Gruß der Morgendämmerung.
Kalidasa (indischer Dramatiker)