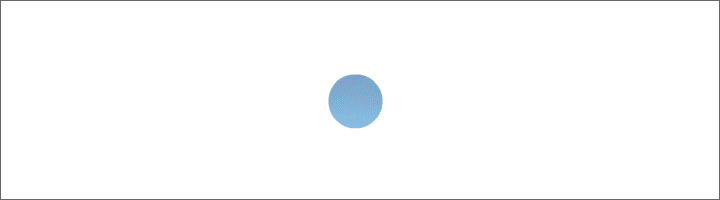Mariechen
Ich vermute, dass sie Maria hieß, aber von jedem aus unserer Brigade wurde sie liebevoll Mariechen genannt. Mariechen war bereits über achtzig Jahre alt, ließ es sich jedoch nicht nehmen, trotzdem bei der Arbeit in der Hotelküche zu helfen, in der ich meine Lehre als Köchin absolvierte. Sie war froh, dass sie junge Menschen um sich herum hatte und noch gebraucht wurde.
Ohne Menschen, wie Mariechen wäre der Sozialismus nicht denkbar gewesen. Da war jede helfende Hand willkommen. Mariechen putzte Gemüse, schälte Kartoffeln und Zwiebeln, spülte Geschirr und erledigte sonst alle Arbeiten, die sie in ihrem hohen Alter noch bewältigen konnte; kurzum sie war eine Frau mit goldenen Händen.
Nachdem ich meine Lehre zur Köchin im Hotel «Zur Post» begonnen und dort nach etwa einem halben Jahr versucht hatte eines meiner Probleme mit Schlaftabletten zu lösen, war ich für die verbleibende Zeit in das «Hotel Stadt Wurzen» versetzt worden, um dort meinen Facharbeiter zu machen. Zumindest am Anfang hatte ich deshalb eine Sonderstellung inne, die ich aber wissentlich niemals ausgenutzt habe. Im Gegenteil, war diese mir eher peinlich, weil ich immer das Gefühl hatte nicht richtig dazu zu gehören. Von den Lehrunterweisern traute sich niemand mich zu kritisieren, aber ich bekam ja mit, wie der Chef mit den anderen Lehrlingen umging. Meistens brauchte er keinen Ton zu sagen; wenn er mich unter seinen schwarzen buschigen Augenbrauen hervor mit seinem missmutigen Blick ansah, wusste ich ohnehin, was die Glocke geschlagen hatte.
Mariechen behandelte mich jedoch wie alle anderen, dass heißt, sie war gutherzig, fürsorglich und liebenswürdig, aber sie war es zu allen und machte bei niemandem eine Ausnahme. Bei ihr waren auch die kleinen Fehler, die mir passierten bestens aufgehoben, sie war keine, die es an die große Glocke hing, wenn bei mir einmal etwas nicht so klappte, wie es erwartet wurde. Besonders die Spätschichten waren für mich ein kleines Fest, wenn wir beide allein waren und sie mir einige Kniffe unseres Berufes verriet. Als wir uns nach einiger Zeit näher gekommen waren, wurden unsere Gespräche persönlicher. Sie gab manche Story aus ihrem Leben zum Besten und natürlich freute ich mich, wenn sie mir manchmal sagte, dass ich Fortschritte machte und mich, wie sie es ausdrückte «um Einhundertachtzig Grad gedreht hatte».
Wieder einmal waren wir in einer Spätschicht damit beschäftigt für die Frühschicht Kartoffeln und Zwiebeln zu schälen, in der Gaststube saßen nur wenige Gäste, sodass nicht viel zu tun war. Deshalb hatten wir Zeit zum Quasseln und Mariechen erzählte mir etwas «von früher». Damit war sie bei mir an der richtigen Adresse und heute genieße ich es noch viel mehr, weil ich inzwischen dahinter gekommen bin, dass es nicht nur die Geschichten der Menschen sind, die mir gefallen, sondern mich vor allem das Vertrauen freut, welches diese mir entgegen bringen, indem sie mir ihre kleinen Geheimnisse anvertrauen.
Viele Menschen, die stolz auf eine Leistung oder ein überstandenes Abenteuer sind, schmücken ihre Erzählungen aus, was manchmal den Verdacht nahelegt, dass sie ein sehr selektives Gedächtnis haben und Fakten zu ihren Gunsten verbiegen, hinzufügen oder weglassen. Die Einfachheit der Formulierungen, die nicht viel Aufhebens von einer Leistung macht, vermittelt aber meist die wahre Größe einer Tat, gerade, weil der Erzähler realistisch und ohne Schwärmerei berichtet. So war es auch mit Mariechens Geschichte; die paar dürren Worte, die sie mir hinwarf vermittelten in keiner Weise ihre Gefühle oder die Gefahr, in der sie schwebte. Erst lange Zeit nach unserem Gespräch wurde mir das Ausmaß ihrer Tat bewusst, wie viel Mut und Zivilcourage notwendig waren, um so zu entscheiden , wie sie es getan hatte, weil man die Kühnheit, mit der Mariechen ihre Entscheidung getroffen hatte, nur nach einigem Nachdenken über die geschichtlichen Zusammenhänge begreifen konnte.
Es war vielleicht ein Jahr vor Kriegsende, als sich diese Geschichte ereignete und Mariechens Mann lag bereits seit einigen Jahren unter der Erde. Sie verriet mir, dass sie im Nachhinein für ihn froh darüber war, denn er war nicht nur Halbjude sondern auch noch an den Rollstuhl gefesselt gewesen - beides Tatsachen, die ein Überleben im Deutschland der dreißiger und vierziger Jahre des vorigen Jahrhunderts eher unwahrscheinlich machten. Ob das bei dem Geschehen eine Rolle spielte wird wohl nicht mehr zu ermitteln sein. Ich denke jedoch, dass die Leute, die eines Tages an der Haustür ihres Eigenheimes klingelten, aus dem Wissen um diese Umstände, Hilfe bei ihrer Aktion eher von ihr, als von Anderen ohne diesen Hintergrund, erhofft haben könnten. Mariechen ließ einen Mann und eine Frau herein, die eine wichtige Sache mit ihr besprechen wollten. Die beiden outeten sich, als dem Widerstand zugehörig. Sie schmuggelten aus Lagern befreite Polen aus Deutschland und baten Mariechen, für eine Nacht ihren Keller nutzen zu dürfen, um für zwei dieser Menschen eine Übernachtung zu ermöglichen. Sie sollte einige Nahrungsmittel in den Keller stellen, ein paar Decken hinlegen, die Türe offen lassen und ansonsten so wenig wie möglich von der Sache wissen. Kurze Zeit später waren eines Morgens die Decken zerwühlt, die Nahrungsmittel verschwunden und die Sache erledigt. Herrn und Frau „Widerstand“ hat Mariechen nie wieder gesehen.
1944 war noch nicht abzusehen, dass der zweite Weltkrieg im Mai 1945 beendet sein würde. Der Mann und die Frau hätten auch Angehörige der Gestapo sein können, welche die Loyalität der Menschen testen sollten und innerhalb weniger Momente musste Mariechen darüber entscheiden, ob sie den Beiden vertrauen wollte, denn noch Wochen, Tage und selbst Stunden vor Kriegsende, wurden Leute verhaftet, gehenkt oder erschossen, die Zweifel an Deutschlands Endsieg zu äußern wagten. Oma Tilde hatte mir einmal erzählt, dass eine Frau in einer Heinersdorfer Dorftratschrunde lauthals verkündet hatte, dass ihr Mann der Meinung war, dass der Krieg nicht mehr zu gewinnen sei - binnen Stunden war er verhaftet worden und auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Das alles sind Fakten, die mir bei dieser Erzählung nachträglich eine Gänsehaut verursachen, weil es das wirkliche Leben und kein Buch ist, welches man wieder in die Ecke legt, wenn man es nach Seite Zweihunderteinundzwanzig zu ende gelesen hat. Diese Geschichte bewies mir eigentlich nur, dass die wirklichen Helden im Verborgenen wirken und höchstens einmal nebenbei darüber sprechen. Mariechens Geschichte wird nie auf der Seite eines Geschichtsbuches erscheinen, doch all den Klugscheißern, die uns im Staatsbürgerkunde- oder Geschichtsunterricht erzählen wollten, wie heldenhaft es ist für «eine gerechte Sache» in den Tod zu gehen kann ich deshalb nur entgegen halten, dass es sicherlich mutig ist, für die Rettung anderer Menschen sein Leben zu riskieren. Doch sollte jeder, dem eine solche Entscheidung abverlangt wird, nur seinem Gewissen verpflichtet sein. Außerdem sollte es immer eine persönliche Entscheidung des Einzelnen und keinesfalls die Doktrin von Politikern sein, die bei jeder Gefahr, die ihrem Volke droht, im Bunker verschwunden sind und Heldentaten entweder gleich anderen überlassen oder höchstens mit ihrem großen Maul vollbringen. Damit, denke ich ist alles gesagt. Ende Gelände und aus die Maus! Oder wie denken Sie darüber?